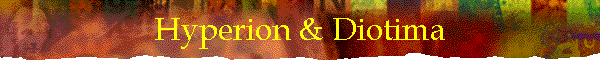Warum erzähl' ich dir und wiederhole mein Leiden und rege die ruhelose
Jugend wieder auf in mir? Ists nicht genug, Einmal das Sterbliche durchwandert
zu haben? warum bleib' ich im Frieden meines Geistes nicht stille?
Darum, mein Bellarmin! weil jeder Athemzug des Lebens unserm Herzen werth
bleibt, weil alle Verwandlungen der reinen Natur auch mit zu ihrer Schöne
gehören. Unsre Seele, wenn sie die sterblichen Erfahrungen ablegt und allein
nur lebt in heiliger Ruhe, ist sie nicht, wie ein unbelaubter Baum? wie ein
Haupt ohne Loken? Lieber Bellarmin! ich habe eine Weile geruht; wie ein Kind,
hab' ich unter den stillen Hügeln von Salamis gelebt, vergessen des Schiksaals
und des Strebens der Menschen. Seitdem ist manches anders in meinem Auge
geworden, und ich habe nun so viel Frieden in mir, um ruhig zu bleiben, bei
jedem Blik ins menschliche Leben. O Freund! am Ende söhnet der Geist mit allem
uns aus. Du wirsts nicht glauben, wenigstens von mir nicht. Aber ich meine, du
solltest sogar meinen Briefen es ansehn, wie meine Seele täglich stiller wird
und stiller. Und ich will künftig noch so viel davon sagen, bis du es glaubst.
Hier sind Briefe von Diotima und mir, die wir uns nach meinem Abschied von
Kalaurea geschrieben. Sie sind das liebste, was ich dir vertraue. Sie sind das
wärmste Bild aus jenen Tagen meines Lebens. Vom Kriegslärm sagen sie dir
wenig. Desto mehr von meinem eigneren Leben und das ists ja, was du willst. Ach
und du must auch sehen, wie geliebt ich war. Das konnt' ich nie dir sagen, das
sagt Diotima nur.
StA, Band 3, Seite 102-103.
Hyperion an Diotima XXXVIII
Ich bin erwacht aus dem Tode des Abschieds, meine Diotima! gestärkt, wie aus
dem Schlafe, richtet mein Geist sich auf.
Ich schreibe dir von einer Spize der Epidaurischen Berge. Da dämmert fern in
der Tiefe deine Insel, Diotima! und dorthinaus mein Stadium, wo ich siegen oder
fallen muß O Pelopones! o ihr Quellen des Eurotas und Alpheus! Da wird es
gelten! Aus den spartanischen Wäldern, da wird, wie ein Adler, der alte
Landesgenius stürzen mit unsrem Heere, wie mit rauschenden Fittigen.
Meine Seele ist voll von Thatenlust und voll von Liebe, Diotima, und in die
griechischen Thäler blikt mein Auge hinaus, als sollt' es magisch gebieten:
steigt wieder empor, ihr Städte der Götter!
Ein Gott muß in mir seyn, denn ich fühl' auch unsere Trennung kaum. Wie die
seeligen Schatten am Lethe, lebt jezt meine Seele mit deiner in himmlischer
Freiheit und das Schiksaal waltet über unsre Liebe nicht mehr.
StA, Band 3, Seite 103-104.
Diotima an Hyperion XLVII
Ich habe die Briefe erhalten, mein Hyperion, die du unterwegens mir
schriebst. Du ergreifst mich gewaltig mit allem, was du mir sagst, und mitten in
meiner Liebe schaudert mich oft, den sanften Jüngling, der zu meinen Füßen
geweint, in dieses rüstige Wesen verwandelt zu sehn.
Wirst du denn nicht die Liebe verlernen?
Aber wandle nur zu! Ich folge dir. Ich glaube, wenn du mich hassen könntest,
würd' ich auch da sogar dir nachempfinden, würde mir Mühe geben, dich zu
hassen und so blieben unsre Seelen sich gleich und das ist kein
eitelübertrieben Wort, Hyperion.
Ich bin auch selbst ganz anders, wie sonst. Mir mangelt der heitre Blik in
die Welt und die freie Lust an allem Lebendigen. Nur das Feld der Sterne zieht
mein Auge noch an. Dagegen denk' ich um so lieber an die großen Geister der
Vorwelt und wie sie geendet haben auf Erden, und die hohen Spartanischen Frauen
haben mein Herz gewonnen. Dabei vergess' ich nicht die neuen Kämpfer, die
kräftigen, deren Stunde gekommen ist, oft hör' ich ihren Siegslärm durch den
Pelopones herauf mir näher brausen und näher, oft seh' ich sie, wie eine
Kataracte, dort herunterwoogen durch die Epidaurischen Wälder und ihre Waffen
fernher glänzen im Sonnenlichte, das, wie ein Herold, sie geleitet, o mein
Hyperion! und du kömmst geschwinde nach Kalaurea herüber und grüßest die
stillen Wälder unserer Liebe, grüßest mich, und fliegst nun wieder zu deiner
Arbeit zurük; – und denkst du, ich fürchte den Ausgang? Liebster! manchmal
wills mich überfallen, aber meine größern Gedanken halten, wie Flammen, den
Frost ab. –
Lebe wohl! vollende, wie es der Geist dir gebeut! und laß den Krieg zu lange
nicht dauern, um des Friedens willen, Hyperion, um des schönen, neuen, goldenen
Friedens willen, wo, wie du sagtest, einst in unser Rechtsbuch eingeschrieben
werden die Geseze der Natur, und wo das Leben selbst, wo sie, die göttliche
Natur, die in kein Buch geschrieben werden kann, im Herzen der Gemeinde seyn
wird. Lebe wohl.
StA, Band 3, Seite 115-116.
Hyperion an Diotima LI
Ich habe gezaudert, gekämpft. Doch endlich muß es seyn.
Ich sehe, was nothwendig ist, und weil ich es sehe, so soll es auch werden.
Misdeute mich nicht! verdamme mich nicht! ich muß dir rathen, daß du mich
verlässest, meine Diotima.
Ich bin für dich nichts mehr, du holdes Wesen! Diß Herz ist dir versiegt,
und meine Augen sehen das Lebendige nicht mehr. O meine Lippen sind verdorrt;
der Liebe süßer Hauch quillt mir im Busen nicht mehr.
Ein Tag hat alle Jugend mir genommen; am Eurotas hat mein Leben sich müde
geweint, ach! am Eurotas, der in rettungsloser Schmach an Lacedämons Schutt
vorüberklagt, mit allen seinen Wellen. Da, da hat mich das Schiksaal
abgeerndtet. – Soll ich deine Liebe, wie ein Allmosen, besizen? – Ich bin so
gar nichts, bin so ruhmlos, wie der ärmste Knecht. Ich bin verbannt, verflucht,
wie ein gemeiner Rebell und mancher Grieche in Morea wird von unsern
Heldenthaten, wie von einer Diebsgeschichte, seinen Kindeskindern künftighin
erzählen.
Ach! und Eines hab' ich lange dir verschwiegen. Feierlich versties mein Vater
mich, verwies mich ohne Rükkehr aus dem Hause meiner Jugend, will mich nimmer
wieder sehen, nicht in diesem, noch im andern Leben, wie er sagt. So lautet die
Antwort auf den Brief, worin ich mein Beginnen ihm geschrieben.
Nun laß dich nur das Mitleid nimmer irre führen. Glaube mir, es bleibt uns
überall noch eine Freude. Der ächte Schmerz begeistert. Wer auf sein Elend
tritt, steht höher. Und das ist herrlich, daß wir erst im Leiden recht der
Seele Freiheit fühlen. Freiheit! wer das Wort versteht – es ist ein tiefes
Wort, Diotima. Ich bin so innigst angefochten, bin so unerhört gekränkt, bin
ohne Hoffnung, ohne Ziel, bin gänzlich ehrlos, und doch ist eine Macht in mir,
ein Unbezwingliches, das mein Gebein mit süßen Schauern durchdringt, so oft es
rege wird in mir.
Auch hab' ich meinen Alabanda noch. Der hat so wenig zu gewinnen, als ich
selbst. Den kann ich ohne Schaden mir behalten! Ach! der königliche Jüngling
hätt' ein besser Los verdient. Er ist so sanft geworden und so still. Das will
mir oft das Herz zerreißen. Aber einer erhält den andern. Wir sagen uns
nichts; was sollten wir uns sagen? aber es ist denn doch ein Seegen in manchem
kleinen Liebesdienste, den wir uns leisten.
Da schläft er und lächelt genügsam, mitten in unsrem Schiksaal. Der Gute!
er weiß nicht, was ich thue. Er würd' es nicht dulden. Du must an Diotima
schreiben, gebot er mir, und must ihr sagen, daß sie bald mit dir sich
aufmacht, in ein leidlicher Land zu fliehn. Aber er weiß nicht, daß ein Herz,
das so verzweifeln lernte, wie seines und wie meines, der Geliebten nichts mehr
ist. Nein! nein! du fändest ewig keinen Frieden bei Hyperion, du müßtest
untreu werden und das will ich dir ersparen.
Und so lebe denn wohl, du süßes Mädchen! lebe wohl! Ich möchte dir sagen,
gehe dahin, gehe dorthin; da rauschen die Quellen des Lebens. Ich möcht' ein
freier Land, ein Land voll Schönheit und voll Seele dir zeigen und sagen: dahin
rette dich! Aber o Himmel! könnt' ich diß, so wär' ich auch ein andrer und so
müßt' ich auch nicht Abschied nehmen – Abschied nehmen? Ach! ich weiß
nicht, was ich thue. Ich wähnte mich so gefaßt, so besonnen. Jezt schwindelt
mir und mein Herz wirft sich umher, wie ein ungeduldiger Kranker. Weh über
mich! ich richte meine lezte Freude zu Grunde. Aber es muß seyn und das Ach!
der Natur ist hier umsonst. Ich bin's dir schuldig, und ich bin ja ohnediß dazu
geboren, heimathlos und ohne Ruhestätte zu seyn. O Erde! o ihr Sterne! werde
ich nirgends wohnen am Ende?
Noch Einmal möcht' ich wiederkehren an deinen Busen, wo es auch wäre!
Aetheraugen! Einmal noch mir wieder begegnen in euch! an deinen Lippen hängen,
du Liebliche! du Unaussprechliche! und in mich trinken dein entzükend
heiligsüßes Leben – aber höre das nicht! ich bitte dich, achte das nicht!
Ich würde sagen, ich sei ein Verführer, wenn du es hörtest. Du kennst mich,
du verstehst mich. Du weist, wie tief du mich achtest, wenn du mich nicht
bedauerst, mich nicht hörst.
Ich kann, ich darf nicht mehr – wie mag der Priester leben, wo sein Gott
nicht mehr ist? O Genius meines Volks! o Seele Griechenlands! ich muß hinab,
ich muß im Todtenreiche dich suchen.
StA, Band 3, Seite 119-121.
Hyperion an Diotima LII
Ich habe lange gewartet, ich will es dir gestehn, ich habe sehnlich auf ein
Abschiedswort aus deinem Herzen gehoft, aber du schweigst. Auch das ist eine
Sprache deiner schönen Seele, Diotima.
Nicht wahr, die heiligern Akkorde hören darum denn doch nicht auf? nicht
wahr, Diotima, wenn auch der Liebe sanftes Mondlicht untergeht, die höhern
Sterne ihres Himmels leuchten noch immer? O das ist ja meine lezte Freude, daß
wir unzertrennlich sind, wenn auch kein Laut von dir zu mir, kein Schatte unsrer
holden Jugendtage mehr zurükkehrt!
Ich schaue hinaus in die abendröthliche See, ich streke meine Arme aus nach
der Gegend, wo du ferne lebst und meine Seele erwarmt noch einmal an allen
Freuden der Liebe und Jugend.
O Erde! meine Wiege! alle Wonne und aller Schmerz ist in dem Abschied, den
wir von dir nehmen.
Ihr lieben Jonischen Inseln! und du, mein Kalaurea, und du, mein Tina, ihr
seid mir all' im Auge, so fern ihr seid und mein Geist fliegt mit den Lüftchen
über die regen Gewässer; und die ihr dort zur Seite mir dämmert, ihr Ufer von
Teos und Ephesus, wo ich einst mit Alabanda gieng in den Tagen der Hoffnung, ihr
scheint mir wieder, wie damals, und ich möcht' hinüberschiffen ans Land und
den Boden küssen und den Boden erwärmen an meinem Busen, und alle süßen
Abschiedsworte stammeln vor der schweigenden Erde, eh' ich auffliege ins Freie.
Schade, Schade, daß es jezt nicht besser zugeht unter den Menschen, sonst
blieb' ich gern auf diesem guten Stern. Aber ich kann diß Erdenrund entbehren,
das ist mehr, denn alles, was es geben kann.
Laß uns im Sonnenlicht, o Kind! die Knechtschaft dulden, sagte zu Polyxena
die Mutter, und ihre Lebensliebe konnte nicht schöner sprechen. Aber das
Sonnenlicht, das eben widerräth die Knechtschaft mir, das läßt mich auf der
entwürdigten Erde nicht bleiben und die heiligen Strahlen ziehn, wie Pfade, die
zur Heimat führen, mich an.
Seit langer Zeit ist mir die Majestät der schiksaallosen Seele
gegenwärtiger, als alles andre gewesen; in herrlicher Einsamkeit hab' ich
manchmal in mir selber gelebt; ich bins gewohnt geworden, die Außendinge
abzuschütteln, wie Floken von Schnee; wie sollt' ich dann mich scheun, den
sogenannten Tod zu suchen? hab' ich nicht tausendmal mich in Gedanken befreit,
wie sollt' ich denn anstehn, es Einmal wirklich zu thun? Sind wir denn, wie
leibeigene Knechte, an den Boden gefesselt, den wir pflügen? sind wir, wie
zahmes Geflügel, das aus dem Hofe nicht laufen darf, weils da gefüttert wird?
Wir sind, wie die jungen Adler, die der Vater aus dem Neste jagt, daß sie im
hohen Aether nach Beute suchen.
Morgen schlägt sich unsre Flotte und der Kampf wird heiß genug seyn. Ich
betrachte diese Schlacht, wie ein Bad, den Staub mir abzuwaschen; und ich werde
wohl finden, was ich wünsche; Wünsche, wie meiner, gewähren an Ort und Stelle
sich leicht. Und so hätt' ich doch am Ende durch meinen Feldzug etwas erreicht
und sehe, daß unter Menschen keine Mühe vergebens ist.
Fromme Seele! ich möchte sagen, denke meiner, wenn du an mein Grab kömst.
Aber sie werden mich wohl in die Meersfluth werfen, und ich seh' es gerne, wenn
der Rest von mir da untersinkt, wo die Quellen all' und die Ströme, die ich
liebte, sich versammeln, und wo die Wetterwolke aufsteigt, und die Berge tränkt
und die Thale, die ich liebte. Und wir? o Diotima! Diotima! wann sehn wir uns
wieder?
Es ist unmöglich, und mein innerstes Leben empört sich, wenn ich denken
will, als verlören wir uns. Ich würde Jahrtausende lang die Sterne
durchwandern, in alle Formen mich kleiden, in alle Sprachen des Lebens, um dir
Einmal wieder zu begegnen. Aber ich denke, was sich gleich ist, findet sich
bald.
Große Seele! du wirst dich finden können in diesen Abschied und so laß
mich wandern! Grüße deine Mutter! Grüße Notara und die andern Freunde!
Auch die Bäume grüße, wo ich dir zum erstenmale begegnete und die
fröhlichen Bäche, wo wir giengen und die schönen Gärten von Angele, und laß,
du Liebe! dir mein Bild dabei begegnen. Lebe wohl.
StA, Band 3, Seite 121-123.